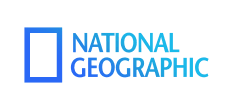Wenn Sie durch das endlose Meer des Internets surfen, stoßen Sie vielleicht auf einige seltsame oder verwirrende Informationen. Dann fragen Sie sich vielleicht, ob sie wahr oder völliger Unsinn sind. Eine dieser viralen Behauptungen kursierte in den letzten Jahrzehnten immer wieder in den sozialen Medien. Viele Menschen - darunter auch einige bekannte Prominente - behaupten, dass Walsperma den Ozean salzig macht. Aber ist das wirklich wahr oder nur ein weiterer Internet-Hoax, der im Netz kursiert?
Fortpflanzung der Wale

In den letzten Jahrzehnten wurde berichtet, dass Wale während eines einzigen Paarungsakts zwischen 40 und 400 Gallonen (1,51 m³) Sperma freisetzen, wobei nur etwa 10% das Weibchen erreichen. Doch wie genau sind diese Angaben? Machen wir einen kurzen Faktencheck!
Natürliche Auslese
Es stimmt, dass die Wale viele Spermien produzieren müssen. Da sich die Weibchen nacheinander mit mehreren Männchen paaren können, sorgt diese Anpassung dafür, dass die Gene der Männchen erfolgreich weitergegeben werden. In dieser Welt des Spermienwettbewerbs haben Individuen, die mehr Spermien produzieren, möglicherweise größere Chancen auf Fortpflanzungserfolg.
Im Hinblick auf die Evolution könnte dies einer der Gründe dafür sein, dass größere Hoden von der natürlichen Auslese begünstigt und an jüngere Generationen weitergegeben werden.
So haben beispielsweise Nordatlantische Glattwale im Vergleich zu anderen Tieren, die um Spermien konkurrieren, überproportionale Anpassungen entwickelt. Die Forscher vermuten, dass die aquatische Umwelt der wichtigste Einflussfaktor sein könnte.
Im Meer können die Männchen den Zugang der Weibchen zu anderen Männchen nicht einschränken, und im Gegensatz zu den Pottwalen haben sie keine Verhaltensstrategien für den Paarungswettbewerb entwickelt. Infolgedessen verlassen sie sich für eine erfolgreiche Paarung ausschließlich auf ihre Spermamenge und Penislänge.

Studien haben außerdem bestätigt, dass der Spermienwettbewerb die älteren Männchen der Population begünstigt.
Obwohl männliche Glattwale im Alter von etwa acht Jahren zur Fortpflanzung fähig sind, erfolgt die Vaterschaft in der Regel erst später, ab dem Alter von 15 Jahren. Wissenschaftler haben eine Theorie vorgeschlagen, um dieses Phänomen zu erklären, die besagt, dass die Hoden weiter an Größe und Produktivität zunehmen können.
Außerdem ist häufig zu beobachten, dass sich dieselben Männchen jedes Jahr erfolgreich paaren, was zu einem einheitlicheren Genpool für künftige Generationen führt. Diese Verringerung der Vielfalt ist insbesondere für kleine Populationen ein Problem, da sich nachteilige Mutationen leicht ausbreiten können und die Art nicht in der Lage ist, sich an Veränderungen in der Umwelt anzupassen.
Hoden und Sperma von Walen
Wale sind riesige Lebewesen, darunter das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat - der Blauwal. Man könnte also denken, dass ihre Fortpflanzungsorgane ebenfalls riesig sind! Und wenn Sie meinen Artikel über die Penisse der Wale gelesen haben, wissen Sie, dass sie wirklich beeindruckende Geschlechtsteile haben, die bis zu 15% ihrer Körperlänge ausmachen!
Aber wenn es im Internet ein Foto gäbe, auf dem ein Wal mit einem Hodensack so groß wie ein Auto zu sehen wäre, würden Sie sich nicht daran erinnern? Nein, das tun Sie nicht! Das liegt daran, dass ihre Hoden zwar groß sind, aber im Inneren der Körperhöhle verborgen sind.
Normalerweise können Spermien bei einer Körpertemperatur von etwa 35,5° C nicht überleben, da dies zu heiß ist.
Dennoch haben Wale ein einzigartiges Kreislaufkühlsystem um die Hoden herum entwickelt, das kälteres Blut aus den Extremitäten zu den Hoden bringt - im Grunde ein innerkörperliches AC!

Doch obwohl der Blauwal das größte aller Tiere ist, wiegen seine Hoden nur etwa 45 kg pro Stück. Es gibt eine andere Walart, die das locker übertreffen kann! Der Glattwal hat die größten Hoden im Tierreich, die zusammen etwa eine Tonne wiegen und ein Volumen von etwa 4,5 Litern (oder 1,2 US-Gallonen) haben! Wissenschaftler vermuten, dass die riesige Menge an produziertem Sperma dazu verwendet wird, die Konkurrenten auszuspülen. Da jedoch Daten zu diesem Thema unter Wasser nur schwer zu gewinnen sind, kann das Volumen nur grob geschätzt werden, indem gestrandete Tiere seziert werden. Was wir jedoch definitiv wissen, ist, dass die von vielen Internetnutzern erwähnte himmelhohe Menge viel zu viel ist, selbst für ein einzelnes Glattwalmännchen in seinem besten Alter!
Warum sind unsere Ozeane salzig?
Salzgehalt des Ozeans
Der durchschnittliche Salzgehalt der Ozeane der Erde liegt stabil bei etwa 35 PSU (practical salinity unit). PSU ist eine Einheit, die auf den Eigenschaften der Leitfähigkeit des Meerwassers basiert und mehr oder weniger Teilen pro Tausend oder g/kg entspricht, was bedeutet, dass ein Kilogramm Meerwasser etwa 35 g Salze enthält.
Bei den im Meerwasser enthaltenen Salzen handelt es sich hauptsächlich um gelöstes Natriumchlorid, Magnesiumsulfat, Kaliumnitrat, Natriumbicarbonat, Chlorid, Sulfat und Nitrat sowie Karbonat-Ionen.
Woher kommt das Salz?
Die Meere sind alt, und damit meine ich wirklich alt! Vor mehreren Millionen Jahren erhöhten die Gase von Vulkanen den CO2-Gehalt in der Erdatmosphäre, wodurch diese saurer wurde als zuvor. Dieser Prozess führte zu einem höheren Gehalt an gelösten Mineralien, die aus der Lava ausgewaschen wurden und Salzionen bildeten. Diese Mineralien wurden jedoch nicht nur aus der Lava gelöst, sondern auch aus erodiertem Gestein überall auf den Kontinenten. Durch Flüsse und Regen wurden sie dann größtenteils in die Ozeane gespült.
Obwohl einige dieser Prozesse noch im Gange sind, bleibt die Salzkonzentration in den Ozeanen mehr oder weniger konstant. Wie kommt das? Der Grund ist so einfach wie verblüffend: In unseren Ozeanen gibt es Leben! All diese winzigen Meeresorganismen, wie zum Beispiel Bakterien, nutzen die Ionen für ihre Stoffwechselprozesse. Außerdem werden durch chemische Reaktionen regelmäßig neue Mineralien gebildet, die ebenfalls von den Meeresorganismen verarbeitet werden.
Neben den Abflüssen vom Land haben hydrothermale Schlote am Meeresboden, Unterwasservulkanausbrüche und Salzstöcke einen starken Einfluss auf den Salzgehalt unserer Ozeane.

Warum sind Seen nicht salzhaltig?
Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum unsere Meere salzig sind, die Seen aber nicht. Gute Frage! Die Antwort ist so einfach wie verblüffend! Es geht nur um unsere menschliche Wahrnehmung. Seen sind tatsächlich salzig, haben aber eine andere Zusammensetzung der Salze. Sie enthalten weniger Natrium- und Chloridionen, die für den salzigen Geschmack verantwortlich sind, aber sie enthalten immer noch viele andere Salze, die für uns keinen salzigen Geschmack erzeugen.
Außerdem sind Seen in der Regel viel kleiner, und das Wasser ist ständig in Bewegung und wird durch Flüsse und Verdunstung abgeführt. Außerdem wird der fehlende Teil des Wassers regelmäßig durch Süßwasserregen ersetzt.
Es gibt jedoch einige berühmte Beispiele für salzhaltige Seen, wie den Großen Salzsee in Utah (USA) und das Tote Meer in Jordanien.

Sollte ich also Meerwasser trinken?
Wir haben also gelernt, dass der Mythos von den vielen Litern Walsperma nur eine ungebildete Fantasie einiger Leute im Internet ist, aber definitiv nicht wahr!
In Anbetracht all dieser neu gewonnenen Informationen sind wir uns jedoch definitiv einig: Bitte trinken Sie kein Meerwasser, nicht weil es tonnenweise Walsperma enthält, sondern weil es Salzwasser ist. Der hohe Salzgehalt dehydriert Ihren Körper, da Sie nur Urin produzieren können, der einen geringeren Salzgehalt als Meerwasser hat, und daher müssen Sie mehr Wasser urinieren als Sie getrunken haben, um das überschüssige Salz loszuwerden!
Literaturverzeichnis
- Anati, D. A. (1999). Der Salzgehalt von hypersalinen Solen: Konzepte und Missverständnisse. Internationale Zeitschrift für Salzseeforschung, 8, 55-70.
- Campbell, B. G. (Hrsg.). (1972). Sexuelle Selektion und die Abstammung des Menschen, 1871-1971. Chicago, IL:: Aldine Publishing Company.
- Donnelly, B. G. (1967). Beobachtungen über das Paarungsverhalten des Südlichen Glattwals Enbalaena australis. South African Journal of Science, 63(5), 176.
- Eilers, J. M., Sullivan, T. J., & Hurley, K. C. (1990). Der am stärksten verdünnte See der Welt? Hydrobiologia, 199(1), 1-6.
- Fitzpatrick, J. L., & Lüpold, S. (2015). Evolution: große Brüller, kleine Eier. Aktuelle Biologie, 25(22), R1084-R1086.
- Fontaine, P. M., & Barrette, C. (1997). Megatestes: Anatomische Beweise für Spermienkonkurrenz beim Schweinswal.
- Frasier, T. R., Hamilton, P. K., Brown, M. W., Conger, L. A., Knowlton, A. R., Marx, M. K., ... & White, B. N. (2007). Muster des männlichen Fortpflanzungserfolgs bei einer hochgradig promiskuitiven Walart: dem gefährdeten Nordatlantischen Glattwal. Molekulare Ökologie, 16(24), 5277-5293.
- Kelley, T. C., Stewart, R. E., Yurkowski, D. J., Ryan, A., & Ferguson, S. H. (2015). Die Paarungsökologie des Belugas (Delphinapterus leucas) und des Narwals (Monodon monoceros), geschätzt anhand von Metriken des Fortpflanzungstrakts. Meeressäugetierkunde, 31(2), 479-500.
- Mate, B., Duley, P., Lagerquist, B., Wenzel, F., Stimpert, A., & Clapham, P. (2005). Beobachtungen eines weiblichen Nordatlantischen Glattwals (Eubalaena glacialis) bei der gleichzeitigen Kopulation mit zwei Männchen: Belege für Spermienkonkurrenz. Aquatische Säugetiere, 31(2), 157.
- Mogoe, T., Suzuki, T., Asada, M., Fukui, Y., Ishikawa, H., & Ohsumi, S. (2000). Funktionelle Reduktion des südlichen Minkewal (Balaenoptera acutorostrata) Hoden während der Fütterungszeit. Meeressäugetierkunde, 16(3), 559-569.
- Neuenhagen, C., Hartmann, M. G., & Greven, H. (2007). Histologie und Morphometrie der Hoden des Weißseitendelfins (Lagenorhynchus acutus) in Beifangproben aus dem Nordostatlantik. Biologie der Säugetiere, 72(5), 283-298.
- Orbach, D. N., Packard, J. M., Keener, W., Ziltener, A., & Würsig, B. (2019). Hodengröße, Scheidenkomplexität und Verhalten bei Zahnwalen (Odontocetes): Arms race or tradeoff model for dusky dolphins (Lagenorhynchus obscurus), harbor porpoises (Phocoena phocoena), and bottlenose dolphins (Tursiops spp.)? Zeitschrift für vergleichende Psychologie, 133(3), 359.
- Pawlowicz, R., & Feistel, R. (2012). Limnologische Anwendungen der Thermodynamischen Gleichung des Meerwassers 2010 (TEOS-10). Limnologie und Ozeanographie: Methoden, 10(11), 853-867.
- Pitnick, S. S., Hosken, D. J., & Birkhead, T. R. (Eds.). (2008). Spermienbiologie: eine evolutionäre Perspektive. Akademische Presse. Slijper, E. J. (1966). Funktionsmorphologie des Fortpflanzungssystems bei Cetacea. Wale, Delfine und Schweinswale, 277-319